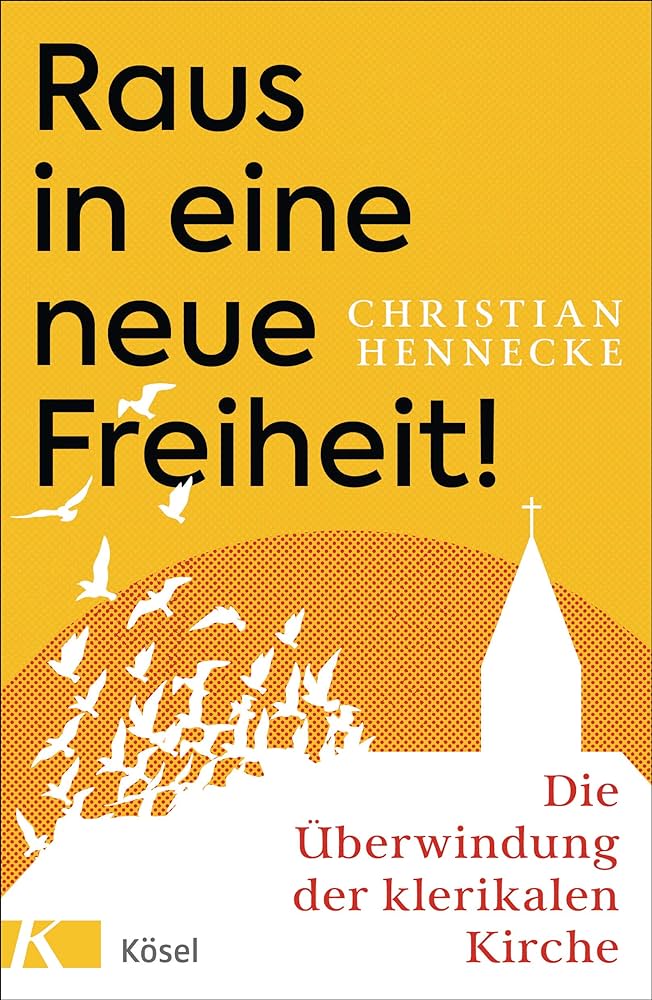Nein, mir geht es nicht um den Erhalt einer bestimmten Kirchenkonstellation. Nein, hier geht es auch nicht um Pastoralpläne der Weiterentwicklung. Nein, es geht auch nicht darum, die Kirche fit zu reformieren – denn das wäre letztlich Systemerhalt, und ehrlich gesagt: wie wir auch hier in dieser Tagung sehen: es hilft nicht, ein wenig oder drastischer das System zu reformieren – es braucht vielleicht mehr.
Genau das ist die These. Deswegen spreche ich von Ekklesiogenesis, und nicht zuerst von Kirchenreform. Deswegen spreche ich von Ursprungsmomenten, und nicht vom Weiterwursteln oder – noch typischer: vom Rechthaben, von Dummen, von Konservativen, Beharrern und Progressiven, von Flügelkämpfen und den gegenabhängigen Kontroversen in den einschlägigen Blasen. Mich überzeugt das nicht, auch wenn es natürlich wichtig bleibt, aufzudecken, was Missbrauch ist, was Systemfailure ist, was Unglaubwürdigkeit meint – dann bestätigt all dies aber dummerweise, was ich zutiefst denke: wir sind am Ende eines Gefüges, und werden es nicht weiterführen können, egal was wir reformieren. Uns nützen keine neuen Postkutschen, wenn wir doch über Emails und Zoom miteinander kommunizieren. Wir sind nicht bei einem Update, auch nicht bei einem Upgrade, sondern einem Wechsel des Betriebssystems. Die Abstürze und Abgründe des bisherigen machen deutlich, dass es so nicht weitergeht. Das bringt Probleme – und auch dazu später.
Und deswegen möchte ich gerne mit euch in den Wald, in den Kirchenwald. Vielleicht ist mir das Bild zum ersten Mal mit den Kolleginnen und Kollegen auf einer Exposuretour in England gekommen, als wir in der anglikanischen Kirche unterwegs waren, um die „fresh expressions of church“ zu erleben – inmitten einer Kirchenlandschaft, die ja gerade auch in England sehr traditionskräftig geprägt ist. Die anglikanischen Geschwister sprachen eben nicht nur von „fresh expressions“ – von ungewöhnlichen Kirchengründungen und -entwicklungen, die sich durch leidenschaftliche Christinnen und Christen in allen Teilen und an vielen unterschiedlichen Orten gebildet haben.
Die anglikanischen Bischöfe sprachen auch von einer „mixed economy of church“ – und meinen einen dynamischen Werde- und Vergehensprozess ohne jede Bewertung, der jedoch den Blick losreisst von einer Vergangenheitsfixierung auf die Gegenwart und den Mut hat, Kirche vom Ursprung neu und vielfältig zu denken. Das war nicht immer so. Auch dazu gleich mehr.
Aber: mixed economy – „Mischwirtschaft“ – das klingt für uns etwas überökonomisch, und deswegen komme ich, kamen wir zu einem anderen Bild, das aber – so finde ich – genau jene Dynamik in den Blick rückt, die ich hier unterstreichen möchte und die ich auch theologisch eingründen möchte. Das Bild vom Wald ist auch nur ein Bild – aber es macht deutlich, dass es hier um ein dynamisches Geschehen geht, um Sterben und Leben, um ein lebendiges und dynamisches Ökosystem, um Klimawandel und um Evolution, um Ursprünge und Absterben – und darum, dass die Zeit der Monokulturen und forstwirtschaftlichen Pastoralmacht zu Ende ist.
So ist vielleicht „kirchlicher Mischwald“ auch noch zu zahm – geht es nicht eher um einen gewollten und programmatischen Verzicht auf Kontrolle, der allerdings nicht dasselbe ist wie laissez faire, sondern eine klare theologische Option für das Evangelium: es könnte auch sein, dass ein kleiner Urwald entsteht, der aber sehr wohl beförstert und geleitet wird, geht es doch immer darum, dem Evangelium Wirksamkeit zu ermöglichen – jenseits der Bilder, die wir haben und diesseits der Fantasie des Reiches Gottes.
Im Einzelnen möchte ich jetzt genauer hinschauen
Das Ende des Harzes
In diesem Coronasommer bin ich ein paarmal in den Harz gefahren, jenes hübsche kleine Mittelgebirge, mit viel Wald. Mit viel Wald? Wer über Torfhaus den Harzhighway der Biker befährt, sieht erschreckendes. Riesenflächen an kahlen Fichten oder Tannen zwischen kleinen Flecken von hoffentlich noch gesunden Bäumen. Es wirkt wie eine Wüste. Die Ursachen sind klar. In den letzten Jahrzehnten setzte man auf eine Monokultur, und dann kam der Klimawandel mitsamt dem Borkenkäfer.
Ich wandere durch die gestalteten Wege – und oft wird es eine schön abenteuerliche Kletterei über gefallene Bäume, gesägte oder umgestürzte. Es ist ein deutliches Bild. Hier ist eine Transformation im Gang – aber: es ist keineswegs alles tot, im Gegenteil. Es wächst neues, aber eben sehr anders.
Spannend ist die Reaktion der Harzförster:innen: nein, es wird nicht dasselbe wieder gepflanzt. Gespannt achten sie darauf, was neu wächst – und behutsam werden neue Baumsorten mitgepflanzt, ohne eine Garantie dafür, dass das sich dann durchsetzt. Und klar ist auch: es wird situativer, unvorhersehbarer, und vielleicht nicht mehr so wirtschaftlich nutzbar. Vielleicht aber doch – wer weiß schon, was nachhaltiger Urwald bewirken möchte, gerade auch in Zeiten des Klimawandels. Offen für diese Zukunft, nicht planlos, aber doch Raum gebend – ein spannender Weg, heute einen Wald wachsen zu lassen…
Hinzu kommt eine andere Idee: was zu Ende geht und zusammenbricht, das ist nicht nutzlos. Man kann es weiterverwenden, mindestens zum Teil dient es als Bauholz für anderes – und der Rest wird Humus: Nährboden für das neue Leben.
Das Bild spricht sofort, wenn wir es auf die Kirche in ihrer derzeitig endzeitlichen Verfasstheit volkskirchlicher Gefüge projizieren. Es ist natürlich mit Deutungen verbunden und setzt ein bestimmtes theologisches Grundverständnis voraus, das nicht allen zugänglich ist und sein muss.
Es kommt nämlich ganz drauf an. Die derzeitige populistische und apokalyptische Grundstimmung hat einen anderen Fokus: mit Recht wird der Niedergang der volkskirchlichen und klerikal überformten Kirchengestalt an ihren ungeheuerlichen Missbrauchserfahrungen und den damit freigelegten und sogar zuweilen theologisch legitimierten Systembugs – der verfälschten und kompromittierten DNA der Kirchengestalt – sichtbar. Und darüber gilt es zu streiten. Und hier gibt es auch kein Weiter so.
Aber es gibt ja ohnehin kein Weiter-so, denn dieser Streit darf nicht übersehen, dass die Streitenden selbst in der Gefahr sind, weiterhin selbst eingebunden zu sein und zu wollen in ein bestimmtes Bild und Gefüge. Es wäre nicht das erste Mal, dass hier ein so dichtes Netz von Gegenabhängigkeiten zu Diskussionen führt, die nicht über das hinausführen, was wir schon vor 50 Jahren diskutiert haben. Karl Rahners „Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance“ aus dem Jahr 1972 lässt grüßen.
Ich kann das gerne verdeutlichen: die Freiburger Studie, die den Kirchen einen Niedergang der Kirchenmitgliedschaft und der Steuereinnahmen in ungeahnten Maß attestiert und prognostiziert, geht doch implizit in ihrem Hintergrundbild tatsächlich davon aus, dass die Zielvorstellung der Kirche weiterhin die Fortsetzung einer Vergangenheit ist, die doch selbst seit inzwischen 50 Jahren am Vergehen ist. Die Selbstverständlichkeit des Glaubens, schon damals kontrafaktisch, die Milieuprägung und ihre Übertragung parallele Gemeindewelten, ihr hoher Organisationsgrad. Der Ausbruch in kategoriale Freiheitsräume der Sendung, die hohe Strukturierung, die klerikale Abhängigkeit und ihre in Berufsgruppen ausgeformte Gegenabhängigkeit – und das geheime Wissen darum, dass eine Epoche zu Ende geht – das alles ist nichts neues. Und weist nicht in die Zukunft.
Denn dummerweise machen Katholiken und Protestanten seit Jahrzehnten sowieso, was sie wollen – und reagieren nicht mehr auf Angebote, die sie annehmen sollten. Glauben wird seit Jahrzehnten persönliche Weggeschichte, die sich nicht mehr institutionell kontrollieren lässt, und dennoch funktionieren die Reflexe einer oben-unten Dialektik immer noch. Und die Fragen an diese Kirchengestalt sind seit der Würzburger Synode keine anderen. Freiheit sieht anders aus.
Aber heißt das auch das Ende der Kirche? Selbst wenn alle dringenden Systemhausaufgaben gemacht wären – das System bleibt dysfunktional in einer Welt, die sich komplett verändert hat. Klimawandel gesellschaftlich hat Folgen, die deutlich sichtbar werden. Wer würde im Ernst daran glauben, dass bessere Predigten, Frauen als Priesterinnen (ich habe kein Problem damit), partizipativere Rätestrukturen (die aus der Zeit der katholischen Aktion stammen) wirklich verändernd wirken würden. Denn wir sind längst woanders.
Im postmodernen Mischwald der Kirche
Wieder eine Wanderung. Diesmal in Wülfinghausen. Im kleinen Deister. Ein anderer Wald. Ein Mischwald. Ein wunderbarer Wald – aber obwohl deutlich zu hören ist, wie gesägt und beforstet wird – der Wald wirkt etwas wild. Ein kleiner Urwald. Ich merke es, als ich mit einer Freundin und ihrem Hund auf Wegen gehe. Denn auf einmal endet der Weg, der doch eben noch bei Googlemaps so schön beschrieben war. Und ja, dann ist noch ein anderer Weg in der Nähe. Aber… nicht erkennbar in der Wirklichkeit. Überall Dornen (ich trage den Hund) und dann schlagen wir uns durch, bis es dann tatsächlich wieder Wege zu erkennen gibt. Ein verwunschener Wald, wunderbar… und die Wege bilden sich dort zuweilen erst beim Gehen.
„Mixed economy“, das ist ein echter urwaldiger Mischwald. Und hier wird deutlich, dass das gar nicht so fern ist von unserer Kirchenerfahrung, und hier zugleich deutlich wird, dass diese Wirklichkeit keinesfalls eine harmonisierende Verklärung und optimistische Projektion eigener Kirchenwünsche ist.
Denn zunächst geht es auch ums Sterben. Wie alles, was lebt, sterben muss und sterben darf. Das gilt eben auch für die Kirche. Natürlich ist Sterben nicht schön, natürlich löst Sterben Widerstand, Trauer und Wut aus, Verweigerung und Resignation – wir kennen das aus den Trauerphasen. Und wir wissen auch aus diesen Erfahrungen, dass dann – nach dem Einstimmen, erst neues wachsen kann.
Was tiefenpsychologisch erforscht ist, liegt eigentlich in der DNA des christlichen Lebens: die österliche Dimension des Geheimnisses von Tod und Auferstehung durchprägt christliches Leben – und damit auch die Kirche, auch in ihrer organisationellen, ihrer insitutionellen und ihrer sozialen Gestalt und Form. Das sollte nicht verwundern. Theologisch gesprochen trägt die Kirche diese Dynamik in sich, wie die ganze Schöpfung: „wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein…“ (Joh 12).
Dieser dramatische Wachstumsprozess gehört zum Leben der Kirche, gehört zu ihrem Werden.
Aber umgekehrt: so wie im Harz, aber auch im Deisterurwald – so wächst auch ständig Neues, Unerwartetes. Was im anglikanischen Kontext „fresh expressions“ heißt und sehr diverse und vielfältige Formen kirchlichen Lebens meint, das braucht – aus der ekklesialen Försterperspektive – einen neuen Blick: nein, wir wollen nicht die fetten Eichen und Fichten alleine sehen, sondern auch die Achtsamkeit erwerben, die kleinen und neuen Pflänzchen zu betrachten, die in ihnen gewachsene Frucht des Evangelium wahrzunehmen, und wie Urwaldbotaniker oder Harzbesucher uns freuen lernen an unbekannten und bekannten neuen Formen, neuen Blüten, neuen ekklesialen Obstwiesen.
Es ist ja spannend, genau hier eben nicht neue Baumschulen alter Sorte aufzustellen, sondern entstehen zu lassen, was das Evangelium in unserer Zeit bewirkt. „fresh expressions“ heißen diese Formen in England ja auch deswegen, weil sie verknüpft mit der ursprünglichen Sendung des Evangeliums. Das muss ja, so sagt es die Ordinationsformel in anglikanischen Ordinationsliturgien in jeder Zeit und in jeder Gesellschaft „afresh“ verkündet werden.
Mit anderen Worten: dort, wo Menschen vom Evangelium ergriffen mit ihren Gaben und Charismen das Evangelium mit den Menschen ihrer Zeit teilen, wachsen natürlich neue Formen, treibt es neue Blüten, neue Formen der Gemeinschaft – und Ja: auch neue Strukturen und sogar Paradigmen, die angemessen sind. Erinnert sei hier daran, dass diese adaptive Verkündigung der Stil Jesu, die Herausforderung des II. Vatikanums (GS 44) und die Tiefe des Aggiornamentos ist, von dem wir sprechen.
Und ja: wer durch solche Wege im Wald sucht, der ist nicht vorher mit der Planierraupe durch den Wald gefahren, damit endlich etwas Neues das Alte ersetzt – sondern der hat entdeckt, dass Vielfalt und Mischung, Altes und Neues erst zusammen jenen kirchlichen Mischwald hervorbringen, der die Fülle des Evangeliums für alle Menschen bezeugen kann.
Aber auch: das ist nicht wirklich neu. Das geschieht nur je neu.
Ekklesiogenesis
Wenn man von Ekklesiogenesis, vom Werden der Kirche spricht, muss man dabei eins wissen: es geht zuerst überhaupt nicht um die Kirche, sondern es geht um die Welt und das Evangelium in der Welt. Und es geht nicht um einen pastoral geplanten Vorgang, sondern um einen ursprünglichen Prozess: überall dort, wo das Evangelium heute und hier – und in anderen Zeiten und Kulturräumen – bezeugt, gelebt, verkündet wird, wird diese Mischwald/Urwald Kirche ans Licht kommen, als Verdichtung dieses Evangeliums – mal mehr nachhaltig, prägend, mal fluide und vorübergehend.
Ich habe diese Rede vom Werden der Kirche in den vergangenen Jahren verknüpfen dürfen mit den Ansätzen einer „pastoral d’engendrement“, wie sie im französischen Sprachraum diskutiert werden. Eine „zeugende Pastoral“, eine Pastoral des „Anfangen dürfens“ (Hadwig Müllers Übersetzungsversuch) reflektiert zum einen die neue Situation des Christentums in Europa. Christoph Theobald (Christentum als Stil) beschreibt die Nähe unserer Zeit zu den ursprünglichen Aufbrüchen der Apostelgeschichte. Mit der Leidenschaft des Evangeliums, die um Gastfreundschaft in einer multireligiösen und konstitutiv pluralistischen Weltgesellschaft wirbt, können zarte neue Formen und Spiritualitäten neben den alten durchbeteten Kathedralen wachsen, kann von innen und aus der Kraft der Schrift, die wir miteinander teilen, Weggemeinschaft und Glaubensgemeinschaft werden. Kann – muss nicht, denn es bleibt im Raum der Freiheit und Gnade letztlich immer ein Geschenk, ein sakramentales Ereignis, wenn Kirche wird.
Aber eine doppelte Frage stellt sich hier: Zum einen wäre interessant, uns selbst zu fragen, ob wir auch heute an die überraschende Fruchtbarkeit des Evangeliums glauben, an seine kirchenbildende Kraft, die das Ziel des Reiches Gottes in je provisorischen Gestalten verdichtet. Und zum anderen wäre zu fragen, ob wir mit einen „liebend-neugierigen Blick“ in uns tragen, der er ermöglicht, neues Leben zu entdecken und wachsende Kirche zu schützen und für ihr Wachstum Raum zu schaffen.
Beides sind Glaubensfragen: die erste Frage verlangt uns ab, unsere eigenen Bilder – gelungene oder mißlungene oder schreckliche Erfahrungen der persönlichen oder kollektiv unbewußten kirchlichen Vergangenheit – nicht normativ für die Zukunft gelten zu lassen, sondern mit der Kategorie des demütigen Staunens Kirche als Überraschung in ihrem Sterben und ihrem Neuwerden wahrzunehmen. Das bedeutet einen doppelten Mut: auf der einen Seite gilt es, die wertvollen Traditionen neu zu lesen auf dem Hintergrund der neuen Erfahrungen, die wir reichlich machen können: was bedeutet etwa eigentlich die postkonfessionelle Prägung unserer Traditionen? Wie wird heute Sakramentalität und Segen zu verstehen sein? Welche Formen nimmt Ordination und Struktur an? Was bedeutet es, wenn Charismen und Gaben im Zentrum fluider Kirchlichkeit stehen? Und: sind wir bereit, die klassischen Parameter nicht gegen die neuen Parameter, die sich hoffentlich im Nachdenken der Erfahrungen zeigen werden, auszuspielen. Darf es eine nicht-polarisierende Denkform geben? Glauben wir also, summa summarum, dass Gottes Evangelium auch heute wirkt, sich ein Volk sammelt – aber eben staunenswert anders und vielleicht erschreckend unbekannt?
Auch die andere Frage hat es in sich: Sehen wir, was dieses Evangelium heute anrichtet? Sehen wir, was sich schon zeigt? „Schaut nicht auf das, was früher war. Auf das, was gewesen ist, sollt ihr nicht mehr achten. Seht, ich schaffe Neues – schon sprießt es, merkt ihr es nicht? (Jes 43, 18f).
Mir fällt häufig eine enorme Blindheit auf, die weder mit dem Sterben noch mit dem Werden zurechtkommt. Zum einen gibt es keine Einlinigkeit mehr: es ist nicht so, dass die Vergangenheit flächendeckend stirbt – es ist nicht so, dass es ein homogenes Zukunftsszenario gibt. Ganz im Gegenteil. Wer durch die kirchlichen Mischwälder geht, tut gut daran, seinen Blick für Großes und Kleines, Schräges und Gewohntes zu schärfen. Sie tut gut daran, jenseits der klassischen Fragen von Zugehörigkeit, Taufquote und Kirchgänger, von hohem oder niedrigen Engagement wahrzunehmen, mit wieviel Leidenschaft Menschen heute das Evangelium aufnehmen und aus ihm Zukunft gestalten.
Darf man den Papst zitieren?
„Wir müssen die Stadt von einer kontemplativen Sicht her, das heißt mit einem Blick des Glaubens erkennen, der jenen Gott entdeckt, der in ihren Häusern, auf ihren Straßen und auf ihren Plätzen wohnt. Die Gegenwart Gottes begleitet die aufrichtige Suche, die Einzelne und Gruppen vollziehen, um Halt und Sinn für ihr Leben zu finden. Er lebt unter den Bürgern und fördert die Solidarität, die Brüderlichkeit und das Verlangen nach dem Guten, nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Gegenwart muss nicht hergestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden. Gott verbirgt sich nicht vor denen, die ihn mit ehrlichem Herzen suchen, auch wenn sie das tastend, auf unsichere und weitschweifige Weise, tun“
Und
„Es entstehen fortwährend neue Kulturen in diesen riesigen menschlichen Geographien, wo der Christ gewöhnlich nicht mehr derjenige ist, der Sinn fördert oder stiftet, sondern derjenige, der von diesen Kulturen andere Sprachgebräuche, Symbole, Botschaften und Paradigmen empfängt, die neue Lebensorientierungen bieten, welche häufig im Gegensatz zum Evangelium Jesu stehen. Eine neue Kultur pulsiert in der Stadt und wird in ihr konzipiert. Das erfordert, neuartige Räume für Gebet und Gemeinschaft zu erfinden, die für die Stadtbevölkerungen anziehender und bedeutungsvoller sind.
Das macht eine Evangelisierung nötig, welche die neuen Formen, mit Gott, mit den anderen und mit der Umgebung in Beziehung zu treten, erleuchtet und die grundlegenden Werte wachruft. Es ist notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen entstehen, und mit dem Wort Jesu den innersten Kern der Seele der Städte zu erreichen.“
Ein Weg durch die katholische Landesgartenschau in Hildesheim…
Ich schlage Ihnen einen dritten Wanderweg vor. Durch die Innenstadt von Hildesheim. Bleiben wir bei den Katholiken – wir könnten dasselbe auch bei den evangelischen Geschwistern entdecken. Wer die Innenstadtpfarrei besucht, wie ich es getan habe, stößt zum einen auf eine relativ kleine Gruppe klassisch geprägter Gemeindeglieder. Ja, wenn die Normform kirchlichen Lebens tatsächlich die vielfach upgegradete Gemeindegestalt der 70er Jahre wäre, dann steht es nicht so rosig. Kaum noch Gruppen, wenige Kirchgänger (die eher in den Dom gehen), und vor allem: keiner kommt nach. Traurigkeit und Ratlosigkeit beherrscht das Feld. Und die Augen sind gehalten. Denn wir könnten ja anderes und neues entdecken: im Garten der Pfarrei konstituiert sich – beargwöhnt („Was bringt das denn?“) eine Gemeinschaft von Spirituell Suchenden, der es gelungen ist, auch viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Gärtnerinnen und Gärtner zusammenzubringen. 100 Meter weiter, in der Kirche des Priesterseminars, wächst mehr und mehr eine Gemeinschaft von jungen Familien, die mit einfachen, aber tiefgehenden Gottesdiensten Gemeinschaft schafft, die es in Hildesheim sonst so nicht gibt. Und was ist mit dem „Lüchtenhof“, in dem bald junge Leute eine Lebensschule des Evangeliums gestalten und Gründerinnen und Gründer einen Heimathub finden. Halt, das ist nicht alles: was ist mit der Vinzenzpforte, dem Ort für Wohnsitzlose in Hildesheim, der von Christinnen und Christen gestaltet wird, dem katholischen Altenheim, den katholischen Schulen, dem katholischen Kindergarten und dem katholischen Krankenhaus… der katholischen Kreuzbar für Jugendliche und der spirituellen Oase Heilig Kreuz. Was ist mit der polnischen Gemeinde, deren Leben brummt – und was ist mit dem Frauenkirchort, an dem die Initiative Maria 2.0 andockt.
Kein Mangel, nirgends. Eher die Frage, wie all dies begleitet wird – und wie ein Weg des Wachstums des Evangeliums gebahnt werden kann. All dies zusammen – und nur all dies zusammen – ist die reiche Kirche in der Innenstadt, mit ihrer Vielfalt an Sendungen, an Furchtbarkeit, an Zeugnis. Was fehlt, ist der Blick, der all dies sieht und sein Wachstum begleitet. Dort, wo wir heraustreten aus dem klassischen Gefangenschaften unseres kirchlichen Binnenzirkels, da könnten wir die Fruchtbarkeit des Evangeliums und die ekklesiogenetischen Prozesse einer Kirche im Werden betrachten, uns freuen und daran lernen, wie unser Glauben heute geht.
Und wenn wir schon hinschauen… Dieselbe Landesgartenschau und der städtische ekklesiale Waldspaziergang funktioniert noch krasser im Blick auf die Vergangenheit. Dann würde sich nämlich herausstellen, dass es vor allem der Fülle charismatischer Gaben gestern und heute und heute zu verdanken ist, was wir heute sehen. Es war Angela Merici, die am Ursprung der Schullandschaft steht. Es war Louise de Maurillac, die am Ursprung des Krankenhauses, des Altenheims und der Vinzenzpforte steht. Es waren die Fraterherren, die die Erneuerung der devotio moderna nach Hildesheim brachten. Es waren Kapuziner, Franziskaner, Benediktiner und Karthäuser, die mit der Geistkraft und Leidenschaft ihrer Charismen die Erneuerung der Kirche in den verschiedenen Zeiträumen wirklich werden ließen – und mit ihnen neue Formen und Gestalten des Glaubens parallel und vielfältig wachsen ließen.
Wir sehen: es braucht eine pneumatologische Schärfung der Ekklesiologie (ich denke an Michael Böhnke), um die Wirkkraft des Evangeliums deutlich in den Blick zu rücken.
Und die Pastoral? Und das Amt? Und der Priester?
Wir sind hier, um über die Identität des Priesters nachzudenken. Jedem wird aufgefallen sein, dass ich hier weder von Priestern noch von Hauptamtlichen geredet habe, die für die Erneuerung der Kirche zuständig seien. Sind sie auch nicht. Mich hat immer das Diktum von Georg Bätzing, seligen Angedenkens Regens, in meiner ersten Sitzung als Regens bewegt. Damals, im Jahr 2006, da wollte ich gerne, dass unsere Ausbildung den veränderten kirchlichen Paradigmen Rechnung trägt. Sein Donnerschlag war: „Weißt du, Christian, Priester haben noch nie die Kirche erneuert!“. Ich war nicht ganz sprachlos: „Ich möchte ja nur, dass sie sie nicht verhindern“.
In diesem kurzen Wortwechsel steckt für mich auch der Paradigmenwechsel. Denn eines ist ja klar. Wenn soviel stirbt und aufersteht, dann wird auch die gewachsene Identität des Priesters und aller im pastoralen Dienst zutiefst in Frage gestellt. Und das ist angekommen. Wir merken es an jeder Ecke.
Klar ist: wenn wir nicht einen neuen Zugang zum Ursprung finden, bleibt es bei Priestern, die wir als Macher brauchen. Dann bleibt es beim Oben-Unten klerikaler Provenienz, auch in der modernen Variante von Professionalität und Laientum, dann bleibt es bei den Ehrenamtlichen.
Klar ist auch: auch all dies steht auf dem Prüfstand, wenn wir durch den kirchlichen Mischwald gehen. Welche Försteraufgabe brauchen die, die im Dienst am Wachsen der selbstwachsenden Saat des Evangeliums stehen – und wie kann dies von unserer reichen Tradition neu gelesen werden. Das ist die eigentliche sportliche Aufgabe.
Das stellt auch mich in Frage: Ich bin ja nicht nur Priester, sondern auch Leiter einer Hauptabteilung Seelsorge. Was habe ich zu tun? Ich – wir – spüren immer mehr, dass es nicht um Pastoralpläne geht, sondern um Ermöglichungsräume, und gestaltete Regeln für ein Miteinander, um Unterstützung und Begleitung und Schutz des Wachsenden in gewohnten und neuen Kontexten. Und es geht darum, die liebenden Augen auf das prachtvolle Volk Gottes zu richten, das in der Tat den Weg in die Zukunft finden wird.
Christian Hennecke/12.02.21